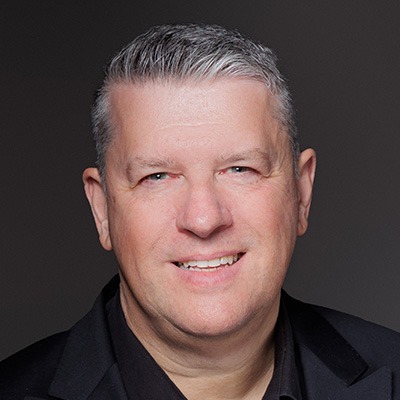Inhaltsübersicht
- Inhaltsübersicht
- Einleitung: Mehr als Technik – warum echte Transformation beim Denken beginnt
- Digitalisierung ≠ Digitale Transformation
- Warum Transformation heute Pflicht ist
- Die zentrale Rolle der Stammdaten
- SPoTs und Datenflüsse: Das Fundament von DFF
- Technologien, die Transformation tragen
- Organisatorische Voraussetzungen
- Wandel mit System: Wie Unternehmen Transformation leben
- Nachhaltigkeit: Strukturen statt Helden
- Resilienz: Beweglichkeit mit Substanz
- Plattformlogik statt Projektdenken
- DFF als strategischer Hebel
- Transformation als Teil der DNA
- Daten als strategisches Asset
- Was Unternehmen jetzt tun können
- Reale Projekte – echte Wirkung
- Schlussgedanke: Transformation ist das neue Normal
- Nächster Schritt: Wenn aus Wissen Wirkung wird
Einleitung: Mehr als Technik – warum echte Transformation beim Denken beginnt
Digitale Transformation ist in aller Munde – und doch bleibt sie oft vage. Zwischen Buzzwords, Tool-Entscheidungen und ambitionierten Projektplänen geht häufig das Wesentliche verloren: die strategische Fähigkeit eines Unternehmens, durch klar strukturierte Datenflüsse und integrierte Systeme flexibel, skalierbar und zukunftsfähig zu agieren.
Dieser Artikel beleuchtet, warum die Basis jeder Transformation in der Art liegt, wie Unternehmen mit ihren Daten umgehen – und warum es nicht ausreicht, einfach nur Systeme einzuführen. Es geht um Denkweisen, Verantwortungen, Strukturen. Und um den entscheidenden Unterschied zwischen Digitalisierung und echter digitaler Transformation.
Digitalisierung ≠ Digitale Transformation
Viele Unternehmen haben den ersten Schritt längst gemacht: analoge Informationen sind weitgehend digitalisiert, papierbasierte Prozesse reduziert, Belege digital. Doch was kommt danach?
Digitalisierung bedeutet, Informationen und Prozesse in digitale Form zu bringen. Ein Beleg wird nicht mehr gefaxt, sondern als PDF per E-Mail verschickt. Der Prozess dahinter bleibt jedoch meist derselbe. Es ist eine Effizienzsteigerung, aber keine strukturelle Veränderung.
Digitale Transformation hingegen geht tiefer. Sie nutzt Technologie, um Geschäftsprozesse, Kundeninteraktionen und sogar Geschäftsmodelle grundlegend neu zu denken. Das bedeutet auch:
· Neue Rollen, neue Verantwortlichkeiten
· Veränderte Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg
· Integration statt isolierter Tools
· Plattformlogik statt Projektdenken
Ein plakatives Beispiel: Das PDF statt Fax ist Digitalisierung. Die vollständige Auftragsabwicklung über integrierte Systeme, von der Beauftragung bis zur Fakturierung und Auslieferung – das ist digitale Transformation.
Exkurs: Excel – der heimliche Transformationsverhinderer
Excel ist ein leistungsfähiges digitales Werkzeug – keine Frage. Doch gerade weil es so flexibel ist, ersetzt es in vielen Unternehmen zentrale Systeme: Preislisten, Produktdaten, Übersetzungen – alles lebt in „dem einen“ Excel. Das verlangsamt Prozesse, erhöht Fehlerrisiken und verhindert Integration. Warum?
· Keine Versionierung oder Historie
· Kein geregelter Zugriff oder Freigabeprozess
· Hohe Fehleranfälligkeit durch manuelle Pflege
· Keine automatischen Validierungen
· Mehrfachkopien in Umlauf
· Keine Integration in Umsysteme
In einer transformierten Systemlandschaft hat Excel deshalb einen klar begrenzten Platz – und keine tragende Rolle.
Warum Transformation heute Pflicht ist
Die wirtschaftliche Realität verändert sich schneller denn je: neue Marktteilnehmer, verändertes Kundenverhalten, regulatorischer Druck, Lieferkettenprobleme. Unternehmen, die sich nicht wandeln, verlieren Anschluss.
Doch Transformation ist kein Selbstzweck. Sie zahlt konkret auf Unternehmensziele ein:
· Effizienz: Durch Automatisierung und klare Datenflüsse
· Time-to-Market: Durch reduzierte Prozesszeiten und bessere Zusammenarbeit
· Kundenerlebnis: Durch konsistente, personalisierte Informationen über alle Kanäle
· Compliance & Sicherheit: Durch saubere, nachvollziehbare Datenhaltung
Und: Transformation stärkt die Resilienz – also die Fähigkeit, in einer BANI-Welt flexibel und wirksam auf Unvorhergesehenes zu reagieren.
BANI steht für brüchig, ängstlich, nicht-linear und unverständlich – ein Konzept, das unsere heutige Welt treffend beschreibt. Mehr zu BANI auf Forbes
Die zentrale Rolle der Stammdaten
Stammdaten sind nicht einfach Informationen – sie sind das strukturelle Rückgrat eines Unternehmens. Produktinformationen, Kundendaten, Lieferantendaten, technische Spezifikationen – sie ermöglichen oder behindern fast jede Aktivität.
Qualitativ hochwertige, vollständige und zentral gepflegte Stammdaten ermöglichen:
· Automatisierte Prozesse (z. B. Content-Publikation, Bestellungen, Logistik)
· Saubere Analysen und fundierte Entscheidungen
· Schnelle Integration neuer Kanäle oder Märkte
Ohne gute Stammdaten keine Transformation.
SPoTs und Datenflüsse: Das Fundament von DFF
Digitale Transformation beginnt nicht mit Prozessen – sie beginnt mit Daten. Das Prinzip „Data Flow First“ (DFF) verändert die Blickrichtung: Statt Abläufe zu optimieren und Systeme daraufhin anzupassen, wird der Informationsfluss zur zentralen Entwurfsgröße. Das ist mehr als eine Methodik – es ist ein Paradigmenwechsel.
Die Wirkung von DFF ist oft disruptiv:
· Prozesse werden nicht mehr entlang von Zuständigkeiten gestaltet, sondern entlang der Datenentstehung und -nutzung.
· Schnittstellen zwischen Abteilungen verlieren an Bedeutung, weil Informationen nahtlos weitergegeben werden.
· Entscheidungen werden nicht mehr zentral gesammelt, sondern dort getroffen, wo die Daten entstehen.
· Der Informationsfluss wird zur neuen Organisationslogik – und verdrängt starre Prozessketten.
Diese neue Logik stellt bestehende Silos infrage. Sie kann bestehende Verantwortlichkeiten verschieben, IT-Architekturen entkoppeln und etablierte Rollen verändern. Genau darin liegt das transformative Potenzial: Wer DFF umsetzt, gestaltet nicht nur effizientere Prozesse, sondern eine agilere, datengetriebene Organisation.
Die erfolgreichsten Unternehmen verfolgen dieses Prinzip von Data Flow First (DFF). Dabei steht nicht der Prozess, sondern der Informationsfluss im Mittelpunkt. Im Zentrum: sogenannte SPoTs – Single Points of Truth.
Was ist ein SPoT?
Ein SPoT ist ein definierter Ort – z. B. ein Modul, Objekt oder Repository in einem System – an dem eine Information entsteht, geprüft und gepflegt wird. Er ist nicht unbedingt der Erzeuger der Information, aber ab Übernahme der Verantwortliche. Von hier aus fließt die Information weiter.
Beispiel: Technische Produktdaten werden im PIM gepflegt (SPoT), von dort aus fließen sie in Webshop, Printsysteme, Marktplätze, Verpackungsprozesse usw.
Warum Datenflüsse entscheidend sind
Der Unterschied zu klassischen Prozessoptimierungen: Traditionelle Ansätze zielen meist auf die Verbesserung einzelner Schritte – etwa durch Zeitersparnis, Umverteilung von Aufgaben oder Outsourcing. Das Ergebnis ist oft ein komplexer Kompromiss. Prozesse werden optimiert, aber selten grundlegend hinterfragt.
DFF hingegen denkt vom Informationsfluss aus. Statt Prozesse leicht anzupassen, werden Datenwege radikal neu entworfen – oft mit völlig neuen Rollen, Systemverknüpfungen und Verantwortlichkeiten.
Nur wenn Daten aus dem SPoT zuverlässig, automatisiert und regelbasiert weitergegeben werden, entsteht Wert:
- Jeder erhält zur richtigen Zeit die richtige Version der Information
- Prozesse werden effizienter, weil weniger Rückfragen nötig sind
- Fehlerquellen durch manuelle Übertragungen entfallen
Datenflüsse ersetzen manuelle Übergaben, steigern Reaktionsgeschwindigkeit und ermöglichen Echtzeitfähigkeit.
SPoTs und DFF sind wie Herz und Kreislauf
- Der SPoT ist das Herzstück, das die Information erzeugt oder in dem Information ankommt, geprüft, gepflegt und bereitgestellt wird
- Der Datenfluss ist der Kreislauf, der die Information verteilt
Nur zusammen funktionieren sie. Ohne SPoTs zerfasert die Datenqualität. Ohne Datenflüsse bleiben SPoTs wirkungslos.
Technologien, die Transformation tragen
Stammdaten und Datenflüsse funktionieren nicht im luftleeren Raum. Sie brauchen Systeme, die nicht nur Daten speichern, sondern sie auch intelligent steuern, pflegen und verteilen. Zwei Säulen tragen diese Architektur: die fachlich spezialisierten Systeme – wie PIM, MDM oder CRM – und die technische Infrastruktur zur Integration dieser Systeme.
Systeme mit klarer Rolle: Wo Daten gepflegt, veredelt und verteilt werden
Die folgenden Systeme sind exemplarisch – sie decken zentrale Bereiche rund um die Pflege, Nutzung und Verteilung von Stamm- und Kontextdaten ab. Manche übernehmen direkte Datenverantwortung (z. B. PIM, MDM), andere arbeiten mit diesen Daten weiter (z. B. CRM, LVS, ERP).
· PIM (Product Information Management): Der SPoT für alle produktbezogenen Informationen – von technischen Daten über Marketingtexte bis zu länderspezifischen Ausprägungen.
· MDM (Master Data Management): Die übergeordnete Instanz zur Pflege unternehmensweiter, domänenübergreifender Stammdaten (Produkte, Kunden, Lieferanten, Materialien etc.).
· DAM (Digital Asset Management): Verwaltet alle digitalen Medien (Bilder, Videos, Dokumente), verknüpft sie mit Stammdatenobjekten und stellt sie kanalübergreifend bereit.
· CRM (Customer Relationship Management): Hält Kundendaten strukturiert und aktuell, steuert Interaktionen über Vertrieb, Service und Marketing hinweg.
· TMS (Translation Management System): Organisiert Übersetzungsprozesse, lokalisiert Inhalte und unterstützt Mehrsprachigkeit entlang des Content Lifecycles.
· LVS (Lagerverwaltungssystem): Versorgt nachgelagerte Prozesse mit verfügbaren Beständen, hilft bei automatisierter Bestell- und Liefersteuerung.
Diese Systeme sollten nicht isoliert betrachtet werden. Richtig integriert, ergänzen sie sich – und sorgen für konsistente Daten über alle Kanäle und Prozesse hinweg.
Integrationsplattformen – Rückgrat moderner Datenflüsse
Systeme entfalten ihren Wert erst dann, wenn sie sauber miteinander verbunden sind. Genau hier setzen Integrationsplattformen an: Sie fungieren als Brücken zwischen isolierten Systemen, Anwendungen und Datenquellen. Dabei geht es nicht nur um technische Konnektoren – es geht um Standardisierung, Nachvollziehbarkeit und vor allem: um Datenflüsse in Echtzeit.
Moderne Integrationsplattformen bieten:
· Konnektoren zu unterschiedlichsten Systemen (z. B. ERP, PIM, CRM, DAM, Webshops)
· Transformation und Mapping von Datenformaten
· Monitoring und Logging der übertragenen Informationen
· Fehlerhandling und Wiederanlaufstrategien
Auf dem Weg zum Ideal gibt es die Möglichkeit, verschiedene Integrationsmuster zu kombinieren: APIs, Event-Streaming, File-basierte Schnittstellen – je nach Anwendungsfall. Damit ermöglichen Integrationsplattformen eine stufenweise Modernisierung ohne „Big Bang“.
Ein besonders zukunftsfähiger Ansatz ist Event Streaming: Systeme senden oder abonnieren Daten als Ereignisse – etwa „Produkt aktualisiert“. Webshop, DAM oder ERP greifen darauf automatisiert zu, ohne direkt gekoppelt zu sein. Das schafft Flexibilität, Echtzeitfähigkeit und Ausfallsicherheit.
Typische Technologien sind z. B. Apache Kafka, Apache Pulsar, Azure Event Hubs, Amazon Kinesis oder Google Cloud Pub/Sub.
In DFF-Strategien spielen Integrationsplattformen eine zentrale Rolle: Ohne robuste und flexible Integration bleibt jeder noch so gut gepflegte SPoT wirkungslos.
Organisatorische Voraussetzungen
Technologie allein verändert kein Unternehmen. Wirkliche Transformation entsteht dort, wo Organisation, Prozesse und Menschen auf die neuen Möglichkeiten abgestimmt werden. Wer DFF wirklich leben will, muss auch strukturell dafür sorgen, dass Datenflüsse nicht durch organisatorische Hürden blockiert werden.
Rollen, die Verantwortung übernehmen
Stammdatenpflege und Datenflüsse brauchen klare Zuständigkeiten. Moderne Organisationen definieren deshalb feste Rollen mit entsprechenden Befugnissen – jenseits traditioneller Linienfunktionen:
· Data Owner (typisch: Fachbereichsverantwortliche): Definieren inhaltlich, welche Daten gepflegt werden sollen und tragen die fachliche Verantwortung.
· Data Steward (typisch: operative Sachbearbeitung, Datenpflege): Sichern im Tagesgeschäft die Datenqualität, koordinieren Pflegeprozesse und klären Auffälligkeiten.
· Data Architect (typisch: IT/Enterprise Architecture): Gestaltet die Systemlandschaft, definiert Datenmodelle und Integrationslogik.
· Data Governance Board (typisch: bereichsübergreifendes Führungsgremium): Setzt Standards, trifft Grundsatzentscheidungen, priorisiert strategische Themen.
Diese Rollen ergänzen sich – keine ersetzt die andere. Gemeinsam stellen sie sicher, dass Datenflüsse nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch funktionieren.
Governance statt Mikromanagement
Gute Datenqualität entsteht nicht durch Kontrolle – sondern durch Vertrauen, Klarheit und die richtigen Rahmenbedingungen. Ein effektives Governance-Modell sorgt für:
· Verbindliche Regelwerke: Wer darf was wann ändern?
· Transparente Prozesse: Welche Workflows gelten für Freigaben, Korrekturen, Übersetzungen?
· Skalierbare Zuständigkeiten: Wer trägt Verantwortung bei wachsenden Teams und internationalen Strukturen?
· Messbare Qualität: Welche KPIs belegen Fortschritte in der Datenqualität?
Governance bedeutet also nicht, mehr Bürokratie einzuführen – sondern den Beteiligten klare Leitplanken zu geben, innerhalb derer sie sicher und effizient agieren können.
Veränderung braucht Struktur
Ein oft unterschätzter Erfolgsfaktor: Transformation bedeutet Veränderung – und die muss geführt werden. Klassisches Change Management ist dabei nicht ausreichend. Was es braucht:
· Stakeholder-Einbindung frühzeitig – insbesondere dort, wo sich Aufgaben oder Zuständigkeiten verändern
· Greifbare Vision und Ziele, warum die Veränderung notwendig ist
· Schulung und Enablement, damit Beteiligte neue Systeme und Prozesse nicht nur bedienen, sondern verstehen
· Kommunikationsformate, die Austausch fördern, statt Ankündigungen zu versenden
Wenn Menschen verstehen, warum sich etwas ändert – und wie sie selbst dazu beitragen – entsteht echte Beteiligung. Und genau diese ist nötig, um Datenverantwortung nachhaltig zu verankern.
Fazit: Organisation schafft Wirkung
Datenflüsse sind nicht nur ein technisches Thema. Sie sind auch Ergebnis einer Organisation, die Verantwortung klar regelt, Rollen definiert und Veränderungen aktiv gestaltet. Erst wenn Technologie und Organisation zusammenspielen, wird aus Digitalisierung echte Transformation.
Wandel mit System: Wie Unternehmen Transformation leben
Digitale Transformation ist kein Projekt mit Enddatum – sie ist ein strategischer Dauerprozess. Unternehmen, die langfristig erfolgreich sein wollen, müssen mehr erreichen als technologische Modernisierung. Sie brauchen zwei strategische Qualitäten:
· Nachhaltigkeit – um Fortschritte dauerhaft zu verankern
· Resilienz – um auf Veränderungen flexibel und stabil reagieren zu können
Beide Aspekte ergänzen sich – und gemeinsam machen sie Transformation zukunftsfähig.
Nachhaltigkeit: Strukturen statt Helden
In vielen Unternehmen treiben Einzelpersonen den Wandel – Projektleiter, CDOs oder Power-User. Sie leisten Großes. Aber: Helden sind nicht skalierbar. Nachhaltige Transformation braucht Organisation, keine Abhängigkeit von Einzelnen.
Deshalb gilt:
· Verantwortung gehört an Rollen, nicht an Personen
· Wissen muss dokumentiert, geteilt und zugänglich sein
· Systeme müssen auch ohne Experten funktionieren
· Erfolge sollten der Organisation gehören – nicht dem Projektteam
Wer diese Strukturen schafft, baut Transformation auf ein stabiles Fundament.
Resilienz: Beweglichkeit mit Substanz
Marktveränderungen, regulatorische Anforderungen, Krisen oder neue Technologien: Unternehmen sind stetigem Wandel ausgesetzt. Resiliente Organisationen reagieren darauf nicht panisch, sondern anpassungsfähig – mit Substanz.
Typische Merkmale:
· Flexible Architekturen, z. B. über lose gekoppeltes Event Streaming
· Skalierbare Datenmodelle, die neue Anforderungen abbilden können
· Steuerbare Automatisierung, statt starrer Prozesse
· Klare Verantwortlichkeiten für alle Datenflüsse und SPoTs
· Eine Kultur, die Veränderung als Normalität begreift
Resilienz zeigt sich in Ausnahmesituationen – etwa bei Systemwechseln, Engpässen oder abrupten Marktveränderungen.
Plattformlogik statt Projektdenken
Viele digitale Initiativen scheitern daran, dass sie in Silo-Logik oder kurzfristigem Projektdenken verharren. Der Webshop braucht bessere Texte? Man implementiert ein unabhängiges Content-Tool. Neue Marktplatzanforderung? Ein weiteres Tool wird manuell gefüttert. Übersetzungen? Katalogweise gepflegt – statt zentral.
Solche Workarounds entstehen aus echtem Druck – aber sie sind langfristig teuer:
· Sie schaffen Datensilos
· Unterwandern Governance-Strukturen
· Erhöhen Pflegeaufwand und Fehleranfälligkeit
Besser: zentrale Plattformen, auf die alle Kanäle und Prozesse zugreifen können. Dazu gehören:
· PIM, DAM, MDM, CRM als verlässliche SPoTs
· Verteilte Verantwortung, klar geregelt durch Governance
· Einheitliche Datenmodelle, die alle Systeme versorgen
· Flexible Integrationen, z. B. per Event-Streaming
DFF als strategischer Hebel
Data Flow First (DFF) ist mehr als Methodik – es ist eine strategische Denkweise. Wer Datenflüsse konsequent ins Zentrum rückt, profitiert mehrfach:
· Datenflüsse entkoppeln Prozesse von starren Systemen
· SPoTs schaffen Klarheit über Zuständigkeiten
· Governance sorgt für verlässliche Qualität
· Echtzeitdaten ermöglichen fundierte Entscheidungen
DFF ist damit ein strategischer Hebel für Wandel, Stabilität und Innovation – besonders in dynamischen Märkten.
Transformation als Teil der DNA
Wenn Veränderung nicht die Ausnahme ist, sondern der Normalfall, entstehen neue Muster:
· Kontinuierliche Verbesserung statt einmaliger Projekte
· Digitale Kompetenzen als Bestandteil jeder Rolle
· Verantwortung für Daten in allen Führungsebenen
· Strategie und IT arbeiten Hand in Hand
So wird Transformation Teil der organisationalen Identität.
Daten als strategisches Asset
In der Industrie zählen Maschinen, Patente oder Marken zu den „strategischen Assets“. Im digitalen Zeitalter gehören Daten eindeutig dazu. Vorausgesetzt, diese sind:
· aktuell, korrekt, strukturiert
· systemübergreifend verfügbar
· eingebettet in Prozesse, Rollen und Governance
Nur dann ermöglichen sie:
· fundierte Entscheidungen
· personalisierte Kommunikation
· Automatisierung mit Vertrauen
· kurze Reaktionszeiten
Was Unternehmen jetzt tun können
Transformation ist ein Weg – kein Schalter. Aber es gibt konkrete erste Schritte:
· Zuständigkeiten definieren – Wer verantwortet welche Daten?
· SPoTs schaffen – Für alle relevanten Datenobjekte
· Systemlandschaften analysieren – Wo herrschen Brüche?
· Kulturarbeit leisten – Wie wird Datenpflege im Alltag verankert?
· Plattformlogik entwickeln – Wo lohnt sich Zentralisierung?
Jeder dieser Schritte erhöht die Zukunftsfähigkeit. Und alle zusammen machen Transformation wiederholbar, robust und strategisch steuerbar.
Reale Projekte – echte Wirkung
Die Theorie ist das eine. Aber wie sieht digitale Transformation mit klarem Fokus auf DFF und SPoTs in der Praxis aus? In zahlreichen Projekten konnten wir beobachten, wie bereits kleine Eingriffe in die Datenverantwortung und Systemarchitektur große Effekte erzeugen – wenn sie strukturiert angegangen und konsequent umgesetzt werden.
Projektbeispiel 1: Strukturierte Produktdaten als Schlüssel zum Erfolg
Ein international tätiger Automobil-Hersteller kämpfte mit fragmentierten Produktinformationen. Unterschiedliche Abteilungen pflegten ihre Daten lokal – mal im PLM, mal im Konfigurator, mal in der Produktbroschüre. Übersetzungen wurden Ausgabe für Ausgabe neu erstellt, ohne zentrale Ablage. Ein PIM-System war geplant, doch das Vertrauen in die Einführung war gering.
Die Lösung: Ein klar definierter SPoT für Produktdaten im PIM, verknüpft mit einem DAM für Mediendateien und einem TMS für Übersetzungen. Event-Streaming-basierte Integrationen stellten sicher, dass neue oder geänderte Produktinformationen automatisch in Online-Kanäle und Printsysteme flossen. Das Ergebnis: schnellere Time-to-Market, konsistente Kommunikation, bessere Kontrolle sensibler Produktinformationen bis zum Launch – und nicht zuletzt eine deutlich entlastete Fachabteilung.
Projektbeispiel 2: Digitale Zwillinge in Gebäudetechnik
Ein Anbieter smarter Gebäudelösungen benötigte ein System zur strukturierten Verwaltung von technischen Anlageninformationen – inklusive Visualisierungen, Sensorwerten und Metadaten. Bis dato wurden Informationen aus verschiedenen Quellen manuell zusammengeführt.
Die Lösung: Aufbau eines MDM-Systems als digitaler Zwilling für SHK-Systeme. Verknüpft mit einem DAM, über das Visualisierungen ausgespielt wurden, und angereichert durch KI-basierte Regelwerke. Ein Frontend ermöglichte die Interaktion mit Echtzeitdaten. Erstmals war durch zentrale Pflege die automatisierte Steuerung, Auswertung und zustandsbasierte Instandhaltung (Predictive Maintenance) im Regelbetrieb möglich.
Projektbeispiel 3: Datenqualität im Gesundheitswesen
Eine Einkaufskooperation mehrerer Kliniken hatte das Ziel, Produktdaten für den medizinischen Einkauf strukturiert zu erfassen und zentral bereitzustellen. Zuvor lagen diese in unterschiedlichsten Formaten und Systemen vor.
Die Lösung: Einführung eines MDM-Systems zur Stammdatenharmonisierung, ergänzt durch klare Data-Governance-Rollen und einen automatisierten Freigabeprozess. Die Folge: verbesserte Verhandlungspositionen, geringerer Pflegeaufwand und bessere Datenqualität für angeschlossene Partner.
Projektbeispiel 4: Governance im Handelsumfeld
Ein international tätiger Lebensmitteleinzelhändler wollte die Pflege und Nutzung seiner Produktinformationen über alle Kanäle hinweg harmonisieren. Das Problem: Unterschiedliche Teams arbeiteten mit eigenen Tools, Dubletten und Medienvarianten waren an der Tagesordnung.
Die Lösung: Aufbau einer integrierten Datenlandschaft auf Basis von PIM, DAM, PLM und ERP – orchestriert über ein zentrales Data Governance Board. Agile Projektmethoden halfen dabei, alle Beteiligten frühzeitig einzubinden und eine nachhaltige Pflegeverantwortung zu etablieren.
Projektbeispiel 5: Produktinformationsmanagement in regulierten Märkten
Ein mittelständisches Unternehmen aus der Pharma- und Chemiebranche stand vor der Herausforderung, Produktinformationen für verschiedene Zielgruppen – Fachkreise, Handel, Endverbraucher – strukturiert und normgerecht bereitzustellen. Bisher wurden diese Informationen verstreut gepflegt – in PDFs, Excel-Tabellen und teilweise direkt in Layoutdateien.
Die Lösung: Einführung eines zentralen PIM-Systems als SPoT für alle relevanten Produktinformationen. Unterstützt wurde die Transformation durch eine agile Projektorganisation mit starkem Business-Analyse-Fokus. Die neue Systemlandschaft ermöglichte eine konsistente Pflege, vereinfachte Freigabeprozesse und sicherte die Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Ein DAM-System ergänzte das Setup und stellte sicher, dass mediale Inhalte gezielt angereichert und kanalübergreifend bereitgestellt werden konnten.
Diese Beispiele zeigen: Digitalisierung wird dort zum Erfolg, wo Systeme mit klarer Verantwortung kombiniert und Datenflüsse nicht nur technisch, sondern strategisch gedacht werden.
Schlussgedanke: Transformation ist das neue Normal
Organisationen, die sich als lernfähige, datengetriebene Systeme verstehen, setzen nicht auf kurzfristige Tools – sondern auf strukturelle Exzellenz.
Transformation wird dort zur Gewohnheit, wo Systeme, Prozesse und Menschen im Gleichklang arbeiten.
Wer heute in klare Datenflüsse, durchdachte Systemlandschaften und gelebte Verantwortung investiert, baut nicht nur Prozesse – sondern Zukunft.
Nächster Schritt: Wenn aus Wissen Wirkung wird
Digitale Transformation ist mehr als Technologie – sie braucht Klarheit, Verantwortung und den Willen zur Veränderung. Und sie gelingt besonders dann, wenn Menschen mit Haltung und Erfahrung zusammenkommen.
SIMIO Consulting versteht Beratung nicht als Produkt, sondern als gemeinsamen Weg: strategisch, strukturiert und getragen von dem Ziel, dauerhaft Substanz zu schaffen.
Wenn Sie spüren, dass mehr möglich ist – aber noch nicht klar ist, wie genau – dann lassen Sie uns darüber sprechen.
Autor
-
Als Principal Advisor für MDM, PIM & DAM ist er Ihr Ansprechpartner für Digitalisierung von Marketing- und Produktkommunikationsprozessen.
Alle Beiträge ansehen